1. Angelschein: Gesetzliche Pflicht und Erwerb
In Deutschland ist der Besitz eines gültigen Angelscheins – oft auch als Fischereischein bezeichnet – eine gesetzliche Voraussetzung, um legal angeln zu dürfen. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie an Flüssen, Seen oder Kanälen mit der Pose angeln möchten. Ziel dieser Regelung ist es, den nachhaltigen Umgang mit Fischbeständen zu gewährleisten und das Tierwohl zu schützen. Die Erlangung des Angelscheins setzt in nahezu allen Bundesländern das Bestehen einer sogenannten Fischerprüfung voraus.
Warum ist ein Angelschein erforderlich?
Der Angelschein dient nicht nur als Nachweis Ihrer Sachkunde im Umgang mit Fischen und Angelgerät, sondern verpflichtet Angler auch zur Einhaltung tierschutzrechtlicher und ökologischer Vorgaben. Das Angeln ohne gültigen Schein wird als Ordnungswidrigkeit geahndet und kann erhebliche Bußgelder nach sich ziehen.
Ablauf der Fischerprüfung
Die Fischerprüfung besteht in der Regel aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Im Theorieteil werden Kenntnisse über Fischarten, Gewässerökologie, Gerätekunde sowie Rechtsvorschriften abgefragt. In manchen Bundesländern ist zusätzlich ein Praxisteil zu absolvieren, bei dem beispielsweise das richtige Zusammenbauen von Angelruten oder das waidgerechte Töten von Fischen demonstriert werden muss.
Vorbereitungskurse und Prüfungsorte
Zur Vorbereitung auf die Prüfung bieten zahlreiche Angelvereine und Volkshochschulen spezielle Kurse an. Diese sind zwar nicht immer verpflichtend, werden jedoch aufgrund der komplexen Inhalte empfohlen. Die Anmeldung zur Fischerprüfung erfolgt meist über die Untere Fischereibehörde oder vergleichbare Stellen der jeweiligen Kommune.
Wo kann man den Angelschein erwerben?
Nach bestandener Prüfung beantragen Sie den Angelschein bei der zuständigen Behörde Ihres Wohnortes – oft beim Bürgeramt oder der Fischereibehörde. In einigen Bundesländern gibt es zudem spezielle Jugendfischereischeine für Minderjährige. Beachten Sie außerdem: Neben dem Angelschein benötigen Sie meist auch eine separate Erlaubnis (Angelkarte) für das jeweilige Gewässer.
2. Gewässerordnung: Rechte und Einschränkungen
In Deutschland ist das Angeln mit der Pose nicht nur von bundesweiten Gesetzen, sondern auch maßgeblich von den jeweiligen Gewässerordnungen abhängig. Diese regeln die Nutzung und Befischung der verschiedenen Gewässertypen und unterscheiden sich teils erheblich zwischen öffentlichen und privaten Gewässern sowie innerhalb der einzelnen Bundesländer. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Aspekte:
Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten Gewässern
| Gewässerart | Zugang & Nutzung | Besondere Regelungen |
|---|---|---|
| Öffentliche Gewässer | Meist zugänglich für alle mit gültigem Fischereischein und Angelkarte. | Strenge Vorgaben zu Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbeschränkungen durch Landesfischereigesetze oder örtliche Verordnungen. |
| Private Gewässer | Zugang nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Eigentümers oder Pächters; häufig zusätzliche Vereinsmitgliedschaft erforderlich. | Spezielle Regeln durch den Eigentümer oder Angelverein (z.B. Gerätelimitierungen, exklusive Angelzeiten). |
Regionale Unterschiede in den Vorschriften
Die Bundesländer regeln die Ausübung der Angelfischerei unterschiedlich. Beispielsweise gibt es Unterschiede bei erlaubten Fangmethoden, Schonzeiten, Mindestmaßen und Nachtangelverboten. Daher sollten Posenangler stets vorab prüfen, welche Vorschriften am gewünschten Gewässerstandort gelten. Informationen bieten lokale Behörden, Angelvereine oder Online-Portale der Landesfischereiverbände.
Notwendige Angelkarten und Dokumente
- Fischereischein: Grundvoraussetzung für das legale Angeln in nahezu allen deutschen Bundesländern.
- Angelkarte/Gewässerschein: Für jedes Gewässer muss eine separate Erlaubnis (Angelkarte) erworben werden – entweder bei Behörden, Vereinen oder online.
- Sonderregelungen: In einigen Regionen sind Tages-, Wochen- oder Jahreskarten üblich; teils existieren spezielle Jugend- oder Gastkarten.
Tipp für Posenangler:
Informieren Sie sich immer rechtzeitig über die geltenden Bestimmungen am jeweiligen Gewässer. Verstöße gegen die Gewässerordnung können empfindliche Strafen nach sich ziehen und zum Ausschluss aus Angelvereinen führen.
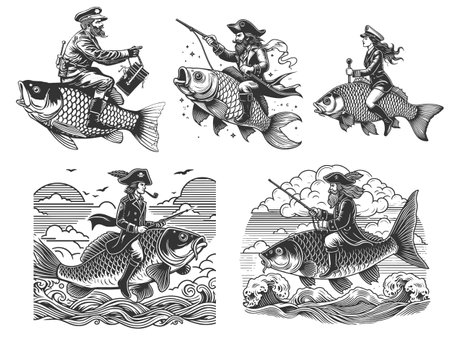
3. Schonzeiten und Mindestmaße
Für Posenangler in Deutschland sind die Einhaltung der Schonzeiten und Mindestmaße essenziell, um den nachhaltigen Fischbestand zu sichern. Die gesetzlichen Regelungen unterscheiden sich zwar je nach Bundesland, doch das Grundprinzip bleibt gleich: Bestimmte Fischarten stehen während ihrer Laichzeit unter besonderem Schutz und dürfen nicht gefangen werden. Zu den besonders geschützten Arten zählen beispielsweise Hecht, Zander, Bachforelle und Aal. Während der jeweiligen Schonzeit – diese kann je nach Art und Region zwischen wenigen Wochen bis mehreren Monaten betragen – ist das Angeln auf diese Arten strengstens untersagt.
Die Mindestmaße legen fest, wie groß ein gefangener Fisch mindestens sein muss, um entnommen werden zu dürfen. Auch hier gibt es Unterschiede je nach Bundesland und Fischart. Beispielsweise beträgt das Mindestmaß für einen Hecht in vielen Regionen 45 oder 50 cm, bei der Bachforelle oft 25 cm. Wird ein untermaßiger Fisch gefangen, muss er unverzüglich und möglichst schonend zurückgesetzt werden.
Verstöße gegen diese Vorschriften werden in Deutschland nicht auf die leichte Schulter genommen. Typische Bußgelder bei Missachtung von Schonzeiten oder Unterschreitung des Mindestmaßes liegen zwischen 50 und 500 Euro – je nach Schwere des Vergehens und Häufigkeit der Zuwiderhandlung. In schweren Fällen kann sogar die Angelberechtigung entzogen oder ein Strafverfahren eingeleitet werden. Es ist daher ratsam, sich vor jedem Angelausflug über die aktuell gültigen Bestimmungen im jeweiligen Bundesland zu informieren.
4. Tierwohl und Umgang mit dem Fang
Beim Posenangeln in Deutschland stehen nicht nur der Fangerfolg, sondern auch das Wohl der gefangenen Fische im Mittelpunkt. Angler müssen sich an eine Vielzahl von Vorschriften halten, die sowohl durch das Bundesnaturschutzgesetz als auch durch die jeweiligen Landesfischereigesetze geregelt sind.
Vorschriften zum Umgang mit gefangenen Fischen
Nach dem deutschen Tierschutzgesetz dürfen Fische nicht unnötig leiden. Dies betrifft insbesondere den Umgang nach dem Fang: Der Fisch muss entweder tierschutzgerecht getötet oder – sofern er untermaßig oder geschont ist – unverzüglich und möglichst schonend zurückgesetzt werden. Das Hältern lebender Fische ist nur in Ausnahmefällen und unter strengen Bedingungen erlaubt.
Tierschutzkonformes Töten
Um Schmerzen und Stress für den Fisch zu vermeiden, ist das fachgerechte und schnelle Töten Pflicht. Die gängigste Methode in Deutschland ist der sogenannte Kopfschlag, gefolgt vom Durchtrennen des Rückenmarks (Kehlschnitt). Unmittelbar nach dem Fang muss diese Prozedur durchgeführt werden. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift kann als Ordnungswidrigkeit oder sogar als Straftat geahndet werden.
Pflicht zur sofortigen Verwertung oder Rücksetzung
| Situation | Vorgeschriebene Handlung |
|---|---|
| Untermaßige oder geschonte Fische | Sofortige und schonende Rücksetzung ins Wasser |
| Maßige und nicht geschonte Fische | Tierschutzgerechtes Töten & unmittelbare Verwertung |
| Nicht verwertbare oder verletzte Fische | Ebenfalls sofortige Rücksetzung, wenn Überlebenschance besteht; andernfalls tierschutzkonformes Töten |
Es ist verboten, gefangene Fische unnötig lange aufzubewahren, um etwa mehrere Exemplare auszuwählen (“Catch and Release” aus reiner Sportlichkeit ist in Deutschland nicht zulässig). Ziel jeder Handlung bleibt stets das Wohl des Tieres sowie die nachhaltige Nutzung der Ressource Fisch.
5. Ausrüstung und erlaubte Fangmethoden
Beim Posenangeln in Deutschland gelten strenge Vorschriften bezüglich der verwendbaren Ausrüstung und Fangmethoden. Diese Regelungen dienen dem Schutz der Fischbestände sowie dem fairen und nachhaltigen Angeln. Im Folgenden werden die wichtigsten Bestimmungen im Detail erläutert.
Anzahl und Art der Ruten
Die zulässige Anzahl der Angelruten beim Posenangeln variiert je nach Bundesland und Gewässerordnung. In den meisten deutschen Bundesländern ist das Angeln mit zwei Ruten gleichzeitig erlaubt, sofern beide unter ständiger Aufsicht stehen. Es gibt jedoch Regionen, in denen nur eine Rute verwendet werden darf oder Sondergenehmigungen erforderlich sind. Die genaue Anzahl ist stets der jeweiligen Gewässerordnung zu entnehmen.
Erlaubte Köder
Für das Posenangeln dürfen sowohl natürliche als auch künstliche Köder eingesetzt werden. Erlaubt sind beispielsweise Würmer, Mais, Maden oder Teig. Auch Kunstköder wie kleine Gummiköder oder Spinner können in bestimmten Fällen zum Einsatz kommen, sofern dies durch die Gewässerordnung nicht ausdrücklich verboten ist. Besonderes Augenmerk gilt hier den Schonzeiten und Mindestmaßen: Während dieser Zeiten dürfen bestimmte Köderarten (z.B. lebende Köderfische) nicht verwendet werden, um geschützte Arten zu schonen.
Verbotene Ausrüstungsgegenstände und Methoden
Bestimmte Ausrüstungsgegenstände sind beim Posenangeln in Deutschland grundsätzlich untersagt. Hierzu zählen insbesondere Echolote zur gezielten Fischsuche während des Angelns sowie das Verwenden lebender Köderfische – letzteres ist im Tierschutzgesetz geregelt und bundesweit verboten. Darüber hinaus kann es regionale Einschränkungen für bestimmte Montagen, Drillinge oder Lockstoffe geben. Moderne Hilfsmittel wie Unterwasserkameras sind ebenfalls meist untersagt, da sie einen unlauteren Vorteil verschaffen würden.
Fazit
Posenangler in Deutschland müssen sich vor jedem Angelausflug genau über die lokal gültigen Bestimmungen zur Ausrüstung und Fangmethode informieren. Nur so lässt sich ein regelkonformes und nachhaltiges Angelerlebnis sicherstellen.
6. Naturschutz und Verhalten am Gewässer
Umweltschutz als zentrale Verantwortung für Posenangler
Der Schutz der Natur spielt für Posenangler in Deutschland eine entscheidende Rolle. Neben den gesetzlichen Bestimmungen rund ums Angeln gelten spezielle Vorschriften, die das Verhalten am und im Gewässer betreffen. Wer mit der Pose angelt, trägt Verantwortung dafür, Flora und Fauna nicht zu beeinträchtigen und nachhaltig mit der Natur umzugehen.
Müllentsorgung: Kein Platz für Abfälle in der Natur
Ein zentrales Thema ist die korrekte Entsorgung von Müll. Es ist strengstens untersagt, jegliche Abfälle – sei es Verpackungsmaterial, Angelschnur oder Köderreste – am Angelplatz zurückzulassen. In vielen Bundesländern drohen bei Missachtung empfindliche Bußgelder. Die Mitnahme eines Müllbeutels sollte für jeden Angler selbstverständlich sein.
Verbot von offenem Feuer
Offene Feuerstellen oder das Grillen am Ufer sind in nahezu allen deutschen Angelgebieten verboten. Der Grund: Waldbrandgefahr und Beeinträchtigung des Lebensraums für Tiere und Pflanzen. Ausnahmen gibt es nur auf ausdrücklich ausgewiesenen Plätzen. Informationen hierzu geben lokale Ordnungsämter oder Angelvereine.
Lärmschutz: Rücksicht auf Mensch und Tier
Lärm kann Fische vertreiben und stört sowohl andere Erholungssuchende als auch die Tierwelt. Daher gilt: Laute Musik, Rufen oder das unnötige Herumwerfen von Gegenständen sind zu vermeiden. Besonders in den frühen Morgenstunden oder bei Nachtangeln ist besondere Rücksicht geboten.
Verhalten in Naturschutzgebieten
Viele attraktive Gewässer liegen ganz oder teilweise in Naturschutzgebieten. Hier gelten verschärfte Regeln: Das Betreten der Uferzonen ist oft nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt, das Mitführen von Hunden kann eingeschränkt sein, und bestimmte Köderarten sind möglicherweise verboten. Informationen über örtliche Bestimmungen bieten meist Hinweisschilder vor Ort oder die Webseiten der zuständigen Behörden.
Fazit: Vorbildliches Verhalten schützt Natur und Zukunft des Angelns
Posenangler sollten sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein und stets darauf achten, geltende Regeln zum Umweltschutz einzuhalten. Nur so bleibt das Angeln an deutschen Gewässern auch für kommende Generationen möglich – im Einklang mit Natur und Gesetz.


